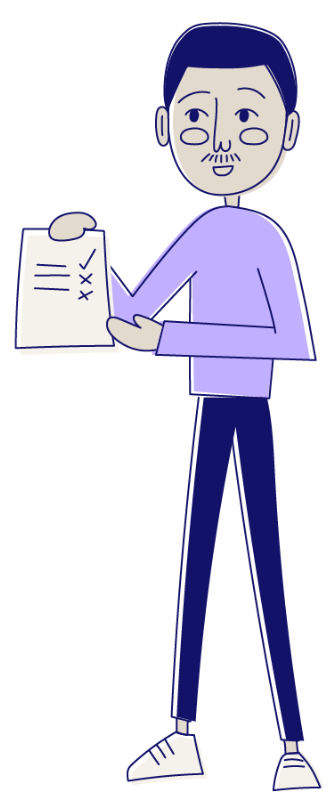Selbstdiagnosen auf Social Media

TikTok hat sich von einer reinen Unterhaltungsplattform für Tanzvideos und Comedy-Clips zu einem Raum entwickelt, in dem zunehmend auch ernste Themen wie psychische Erkrankungen oder ADHS diskutiert werden. Auf TikTok und anderen Social Media Plattformen teilen Betroffene zunehmend persönliche Erfahrungen, geben Tipps zum Umgang mit Symptomen und rufen mitunter sogar teilweise zur Selbstdiagnose auf. Psychische Erkrankungen, über die lange Zeit geschwiegen wurde, erhalten dadurch mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Diese neue Offenheit birgt großes Potenzial für Aufklärung und Enttabuisierung. Gleichzeitig ist jedoch Vorsicht geboten: Selbstdiagnosen können zu Fehleinschätzungen führen – und den Weg zu professioneller Hilfe erschweren.
Trend zur Selbstdiagnose
Die Anzahl an Videos, die sich mit den Themen ADHS und Autismus beschäftigen, hat über die letzten Jahre stark zugenommen. Viele der Videos zeigen alltagsnahe Beispiele von Betroffenen und schaffen so eine direkte Verbindung zu den Zuschauenden. Videos beginnen beispielsweise mit Fragen wie: „Verlierst du schnell das Interesse an Hobbys? Hast du Probleme, dich zu konzentrieren? Kommst du oft zu spät?“ Wer zustimmt, hat laut Videoersteller*innen möglicherweise ADHS oder eine hochfunktionale Depression. Die Kommentarsektion ist oft gefüllt mit Sätzen wie „Endlich verstehe ich mich!“ oder „Das erklärt so Vieles.“
Solche Inhalte wirken besonders auf junge Menschen, die Social Media oft als zentrale Informationsquelle nutzen – auch, wenn es um Gesundheitsthemen geht. Der Algorithmus spielt dabei eine entscheidende Rolle: Wer einmal auf ein entsprechendes Video klickt oder es bis zum Ende schaut, bekommt meist automatisch weitere ähnliche Inhalte ausgespielt.
Mehr Bewusstsein, weniger Stigma
Tatsächlich können diese Videos zahlreiche positive Effekte haben. Sie schaffen Aufmerksamkeit für psychische Gesundheit und können Betroffenen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Gerade bei Erkrankungen, die lange Zeit nicht ernst genommen wurden – wie ADHS bei Frauen – kann so eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema angestoßen werden. Auch für das Umfeld können solche Videos erhellend sein. Viele Betroffene greifen auf entsprechende Videos zurück, um ihren Angehörigen besser zu vermitteln, was ADHS bedeutet und wie es sich für sie anfühlt. Videos auf Plattformen wie TikTok können das Gefühl von Verständnis vermitteln und dazu ermutigen, eigene Symptome ernst zu nehmen und professionelle Hilfe zu suchen.
Herausforderungen: Suggestion und Fehleinschätzung
Doch die Zunahme von Content zum Thema ADHS und anderen psychischen Erkrankungen kann auch Herausforderungen mit sich bringen. Viele dieser Inhalte basieren nicht auf fachlichem Wissen, sondern auf subjektiven Erfahrungen. Die Gefahr besteht darin, dass solche Inhalte komplexe Zusammenhänge vereinfachen und suggestiv wirken – sie können bei Zuschauer*innen den Eindruck erwecken, eine eigene Diagnose sei naheliegend. Wer zwei oder drei allgemeine Symptome bei sich erkennt, fühlt sich schnell betroffen, obwohl diese Symptome auch bei Menschen ohne psychische Erkrankung vorkommen können. Eine neue Studie aus den USA kritisiert, dass viele populäre TikTok-Videos zu diesem Thema inhaltlich erhebliche Schwächen aufweisen. Laut Mediziner*innen sind die darin genannten ADHS-Symptome zu 50% nicht typisch für ADHS, sondern lediglich „normale menschliche Erfahrungen“. Eine medizinische Diagnose für ADHS sei weitaus komplexer, da nicht alle Symptome auf jede Person mit ADHS zutreffen müssten.
Besonders Jugendliche befinden sich in einer Phase der Identitätssuche. Sie hinterfragen ihr Verhalten, ihre Emotionen und vergleichen sich stark mit anderen. In dieser sensiblen Zeit kann eine Selbstdiagnose durch TikTok oder andere Plattformen zu Unsicherheiten, Fehleinschätzungen oder gar einer verstärkten Fixierung auf psychische Probleme führen. Psycholog*innen warnen vor dem sogenannten Selbstdiagnose-Dilemma: Wenn Menschen versuchen, sich selbst zu diagnostizieren, kann es leicht passieren, dass sie ihren eigenen „blinden Fleck“ übersehen. Damit ist der Teil der Wahrnehmung gemeint, der ihnen selbst nicht bewusst ist – also Symptome oder Verhaltensweisen, die sie entweder nicht wahrnehmen oder falsch einschätzen. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine Selbstdiagnose unvollständig oder falsch ausfällt und wichtige Hinweise auf professionelle Hilfe übersehen werden.
Umgang mit Diagnose-Inhalten auf Social Media:
Wie kann nun damit umgegangen werden, wenn der Eindruck entsteht, dass eine Diagnose wie ADHS vorliegt?
- Realitätscheck einholen: Wer sich in einem Video „wiedererkennt“, sollte mit vertrauten Menschen darüber sprechen. Freund*innen oder Familie können eventuell dabei helfen einzuschätzen, ob das Verhalten oder Erleben wirklich auffällig ist.
- Inhalt der Videos hinterfragen: Der Hintergrund der Creator*innen kann Aufschluss darüber geben, ob die gezeigten Inhalte auch tatsächlich auf Erkrankungen wie ADHS hinweisen. Nutzende können sich fragen: Haben Ersteller*innen eine therapeutische, psychologische oder medizinische Ausbildung? Gibt es einen Verweis auf seriöse Quellen?
- Professionelle Hilfe suchen: Wenn die Sorge um die eigene psychische Gesundheit bestehen bleibt, ist der erste Schritt ein Gespräch mit dem*der Hausärzt*in, Psychotherapeut*in oder einer Beratungsstelle wie JugendNotmail.
Tipps und Hinweise
Eltern und pädagogische Fachkräfte spielen eine zentrale Rolle dabei, wie Jugendliche Inhalte von Social Media Plattformen aufnehmen und interpretieren. Wenn Jugendliche durch Videos auf mögliche Symptome aufmerksam werden, ist es wichtig gemeinsam zu reflektieren, ob das Gesehene tatsächlich auf Krankheitssymptome hinweist. Dabei sollten die Gedanken und Gefühle der Jugendlichen ernst genommen und sie einfühlsam bei möglichen weiteren Schritten begleitet werden.
Social Media kann also ein wertvoller Impulsgeber sein, um sich mit der eigenen psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen und Betroffene dabei zu unterstützen, sich miteinander zu vernetzen. Dennoch ersetzen Videos auf Social Media Plattformen keine professionelle Diagnose. Denn nur medizinisches Fachpersonal kann fundierte Diagnosen stellen und angemessene Behandlungswege aufzeigen. Selbstdiagnosen, die auf Social Media Inhalten basieren, können erste Hinweise liefern, sollten daher jedoch stets kritisch hinterfragt und durch professionelle Einschätzungen ergänzt werden.