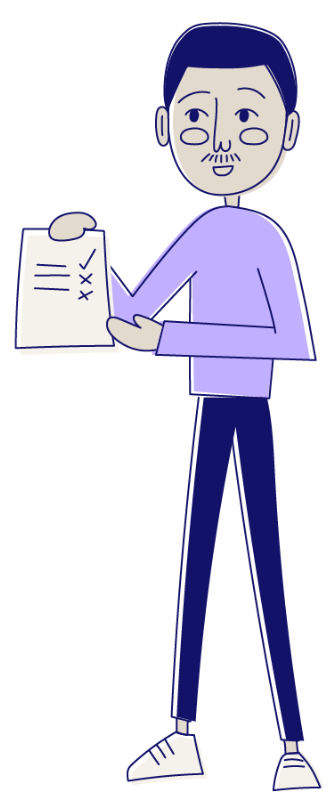Emotionale Verkaufsstrategien auf Social Media

In der Social Media Welt sind Emotionen ein wichtiges Werkzeug, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erlangen. Auf Plattformen wie TikTok oder Instagram treten daher zunehmend Akteur*innen auf, die emotionale Geschichten inszenieren, um ihre Produkte zu verkaufen. Diese Taktiken reichen von angeblichen Geschäftsaufgaben bis hin zu gefälschten Schicksalsschlägen. Auch durch Künstliche Intelligenz generierte Inhalte kommen dafür immer häufiger zum Einsatz.
Mitleid als Verkaufsstrategie
Typisch für diesen Zweck sind Videos, in denen Personen suggerieren, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. In einigen Clips ist beispielsweise eine ältere Frau zu sehen, die unter Tränen schildert, dass sich ihre handgemachten Produkte nicht verkaufen. Mit trauriger Musik unterlegt, appellieren diese Videos an das Mitgefühl der Zuschauenden. In den Kommentaren äußern viele Nutzende ihre Anteilnahme und bieten Unterstützung an. Mittlerweile hat sich die Dame aus dem verlinkten Video zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass diese Videos ohne ihre Erlaubnis verwendet wurden und der Bezug zum vermeintlichen Online-Shop nachträglich eingefügt wurde.
Ein weiteres Beispiel liefert ein Video von einer jungen Frau, die traurig berichtet, dass ihr Bruder ein eigenes Geschäft gründen wollte, aber keine Käufer*innen für seine Produkte findet. Die ganze Familie habe ihre Ersparnisse eingesetzt und nun drohe der Familie der finanzielle Ruin. Auch hier wird Bildmaterial des vermeintlichen Bruders gezeigt, der traurig zwischen verpackter Ware sitzt. Wenn man sich besagte Online-Shops allerdings genauer anschaut, handelt sich meist um minderwertig produzierte Ware aus Massenproduktion.
Gefälschte Geschäftsaufgaben
Ein gezielt manipulativer Trick besteht darin, eine Schließung von Online-Shops vorzutäuschen. In einem Fall verkündeten angebliche Geschäftsführer*innen oder Mitarbeiter*innen, dass sie ihren Shop schließen müssten und daher ihre Ware zu stark reduzierten Preisen abgeben. Dabei wird besonders betont, dass die Aufgabe „schweren Herzens“ geschieht oder „leider niemand ihre Ware kaufen wollte“, um gezielt Mitleid bei den Nutzenden zu erzeugen. Bekannt wurde der Fall des angeblichen Modehändlers namens „David“, der in TikTok Videos von der Schließung seines Geschäfts „david-fashion.com“ berichtete. Das Video wurde allerdings vollständig mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt, und weder der Shop noch die angegebene Stadt „Meerburg“ existieren tatsächlich. Viele Nutzende überwiesen daraufhin Geld an den Schein-Online-Shop.
Warum funktionieren solche Taktiken?
Ein wesentlicher Grund für den Erfolg dieser Werbestrategien liegt in ihrer emotionalen Inszenierung. Inhalte, die Mitleid erzeugen oder Mitgefühl wecken, verbreiten sich auf Social Media besonders schnell – nicht zuletzt, weil Plattform-Algorithmen Beiträge mit vielen Reaktionen und Kommentaren bevorzugt ausspielen. Kommentieren also viele Nutzende ihre Beileidsbekundungen, erzielt das Werbevideo eine größere Reichweite. Die Geschichten hinter den Produkten erwecken dabei gezielt den Eindruck, es handle sich um kleine Familienbetriebe oder handgefertigte Einzelstücke. Viele Nutzende kaufen daraufhin aus dem Wunsch heraus, einer vermeintlich in Not geratenen Person zu helfen. Käufer*innen müssen schließlich feststellen, dass die Produkte sich als standardisierte Massenprodukte herausstellen oder erst gar nicht geliefert werden.
Tipps und Hinweise
Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, ein Bewusstsein für emotionale Verkaufsstrategien zu schaffen. Heranwachsende sollten darin bestärkt werden, emotionale Geschichten in Werbevideos zu hinterfragen und zu prüfen, ob es sich um wahre Geschichten und Personen oder bewusst gewählte Strategien handelt. Bei stark emotional aufgeladenen Inhalten, die Mitleid erwecken oder einen schnellen Kaufdruck erzeugen wollen, sollte deshalb besonders wachsam gehandelt werden. Kinder und jüngere Jugendliche sollten grundsätzlich nur gemeinsam mit einer erwachsenen Bezugsperson Online-Käufe tätigen. Es empfiehlt sich, auf Geräten keine Zahlungsdaten dauerhaft zu speichern, um spontane Käufe zu verhindern.
Zudem können Eltern und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche darauf hinweisen, wie sich unseriöse Shops erkennen lassen. Beispielsweise lassen sich mit einem Screenshot und einer umgekehrten Bildersuche schnell Hinweise finden, ob ein Video oder Bild bereits in anderen Kontexten genutzt wurde und es sich dementsprechend um eine inszenierte Geschichte handelt. Auch der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen bietet eine einfache Möglichkeit, unseriöse Shops zu entlarven. Ein prüfender Blick ins Impressum, die Verfügbarkeit von Käuferschutz sowie die angebotenen Zahlungsmethoden – insbesondere, wenn ausschließlich Vorkasse möglich ist – können ebenfalls Aufschluss über die Seriosität eines Angebots geben.