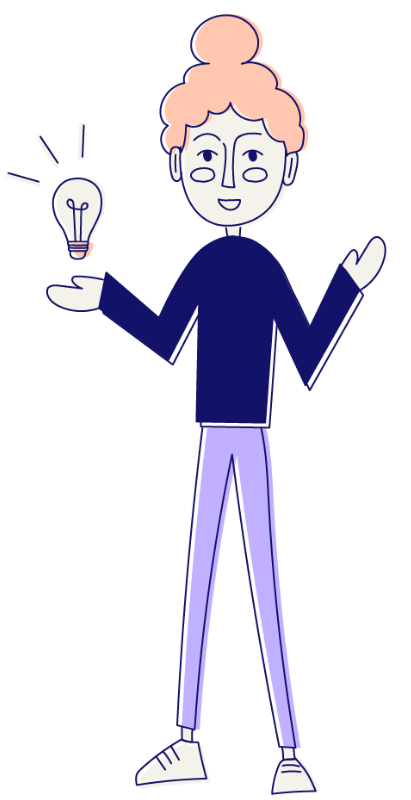KI-Influencer*innen auf Social Media

Influencer*innen gelten als fester Bestandteil von Social Media Plattformen. Sie inspirieren ganze Communities und können dabei Einfluss auf Trends oder Meinungen haben. Dabei stellt sich immer häufiger die Frage, ob die Inhalte, die wir auf Social Media sehen, der Wirklichkeit entsprechen oder mithilfe Künstlicher Intelligenz generiert wurden.
Es gibt Accounts mit Digitalen Avataren, deren gesamter Inhalt von Künstlicher Intelligenz erstellt und geführt wird – sogenannte KI-Influencer*innen. Sie kombinieren modernste Technologien mit kreativem Storytelling und schaffen damit faszinierende, oft verblüffend real aussehende Figuren, die Millionen Menschen erreichen. Doch was steckt hinter KI-Influencer*innen, wie funktionieren sie, und warum folgen Menschen ihnen?
Was sind KI-Influencer*innen?
KI-Influencer*innen bezeichnen digitale Avatare, also computergesteuerte Figuren, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Grafiksoftwares erstellt und gesteuert werden. Zu Beginn des Entstehungsprozesses erfolgt eine ausführliche Konzeption zum Beispiel darüber, welche Persönlichkeit und Werte der Avatar hat und welche Zielgruppe angesprochen werden soll.
Diese virtuellen Influencer*innen interagieren auf digitalen Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube. Dort haben sie ein eigenes Profil und durch einen programmierten Algorithmus posten sie regelmäßig Inhalte oder reagieren auf ihre Follower*innen in den Kommentaren. Die Algorithmen basieren beispielsweise auf Maschinellem Lernen und Neuronalen Netzwerken, wodurch eine menschliche, realistische Art und Weise der Interaktionen simuliert wird. Der produzierte Content wird durch das Analysieren von aktuellen Trends kontinuierlich angepasst.
Nicht alle virtuellen Influencer*innen basieren vollständig auf KI, manche werden mithilfe menschlicher Steuerungen betrieben und geleitet. Dafür werden echte menschliche Bewegungen ins Digitale übertragen, Inhalte geskriptet oder auf Kommentare reagiert.
Warum sind sie so beliebt?
Ähnlich wie reale Influencer*innen bauen sie durch Kommunikation und vermeintlich persönliche Geschichten Sympathie und Vertrauen auf. Allerdings können sie durch gezielte Analyse von Trends und Entwicklungen noch genauer auf die Mediennutzungsbedürfnisse von Menschen eingehen. Besonders Unternehmen, die auf KI-Influencer*innen setzen, machen sich dabei das Prinzip der Parasozialen Beziehung zunutze. Hohe Follower*innenzahlen verstärken darüber hinaus das Gefühl, dass diese Figuren relevant und beliebt sind.
Kennzeichnung von KI-generiertem Content
Auf Instagram, TikTok und Facebook wird eine „KI-Info” herausgegeben, sobald die Beiträge aus generierten Inhalten bestehen. Damit soll für mehr Transparenz gesorgt werden und es soll Nutzenden dabei helfen, echte Fotos und reale Ereignisse von KI-Content unterscheiden zu können. Eine Kennzeichnung kann entweder manuell erfolgen oder durch eine automatische Erkennung, wenn beispielsweise ein Bild von Photoshop mit der KI-Funktion bearbeitet wurde. Allerdings kann diese auch umgangen werden. Eine eigene kritische Reflexion über den konsumierten Content ist somit weiterhin essenziell.
Ab 2026 wird in der Europäischen Union eine Kennzeichnungspflicht gelten. Diese Pflicht betrifft Texte, Bilder sowie Video- und Audioinhalte, die durch Deepfake-Technologien hergestellt wurden.
KI-Influencer*innen erkennen
Auch wenn es teilweise sehr schwer ist, KI-generierte Inhalte als solche zu erkennen, gibt es dennoch ein paar Anhaltspunkte, die dabei helfen können: KI-generierte Bilder und Videos zeigen in einigen Fällen unnatürliche Schatten, haben Fehler oder sich wiederholende Strukturen im Hintergrund. Auch unstimmige Details wie Hände, Haare oder Schmuck können Hinweis auf einen KI-Ursprung geben. Darüber hinaus erscheinen KI-Influencer*innen oft “zu” perfekt, mit glatter Haut und immer gleichen Gesichtszügen. Um sich sicher zu sein, dass ein Profil auch eine echte Person zeigt, kann die Bilder-Rückwärtssuche genutzt werden. Findet man keine Einträge oder Hinweise über Vergangenes aus dem Leben der Person, kann dies ein Indiz dafür sein, dass es sich um das Profil eines*einer virtuellen Influencer*in handelt.
Herausforderungen
KI-Influencer*innen können Einfluss auf das Selbstbild und die Wahrnehmung der Realität nehmen. Durch perfekte, makellose Darstellungen und oft unerreichbare Schönheitsideale kann ein verringertes Selbstwertgefühl entstehen, wenn Menschen sich mit ihnen vergleichen. Viel zu häufig bedienen KI-Influencer*innen geschlechterspezifische Stereotype und wenig Diversität. Besonders im Kontext von Werbepartnerschaften können sie durch ihre scheinbare Authentizität Kaufentscheidungen beeinflussen. Da ihre Aussagen und Handlungen ähnlich aufgenommen werden wie die von echten Influencer*innen, vertrauen einige Nutzende den Kaufempfehlungen genauso wie bei realen Influencer*innen.
Beispiele von KI-Influencer*innen
- Emmatravelsgermany ist eine KI der Deutschen Zentrale für Tourismus. Ihr Content zeigt Reisen zu verschiedenen Orten in Deutschland, sie teilt Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps und beantwortet alle Fragen der Community.
- Noonoouri veröffentlicht Content über nachhaltige Mode und soziale Gerechtigkeit. Sie postet Bilder und Videos an weltweiten Aktionstagen wie Pride, International Day of Forest und ruft mit zum Tierschutz auf.
- Der Account von Itskamisworld steht für eine positive Darstellung von Menschen mit Down-Syndrom. Das Netzwerk „Down-Syndrom International” hat in Zusammenarbeit mit Digital- und Kreativagenturen den KI-Avatar konzipiert, um die Sichtbarkeit von Menschen mit Down-Syndrom auf Instagram zu stärken.
Tipps und Hinweise
Pädagogische Fachkräfte sollten die Faszination von Kindern und Jugendlichen für KI-Influencer*innen nachvollziehen und ernst nehmen. Gleichzeitig gilt es, das Thema sensibel aufzugreifen, um eine reflektierte Auseinandersetzung zu fördern.
Das Wissen über die Kennzeichnung von KI-Content und KI-Influencer*innen kann für Kinder und Jugendliche hilfreich sein, um eine kritische Reflexion über generierten Content anzuregen. Auch ohne die Kennzeichnung von KI generiertem Content sollte dazu ermutigt werden, das Konsumierte auf dessen Echtheit zu überprüfen. Eltern und Fachkräfte können offene Gespräche über KI-Influencer*innen, deren Profile und präsentierten Lifestyle anregen und gemeinsam hinterfragen, wer hinter einem Account steckt und welche Interessen verfolgt werden. Besonders werbliche Absichten sollten gemeinsam besprochen und erkannt werden, sodass die Jugendlichen verstehen, dass Nähe oft bewusst erzeugt wird.
KI-Influencer*innen können sowohl geschlechterspezifische Stereotype und Schönheitsideale darstellen oder gezielt Vielfalt und gegenseitige Akzeptanz repräsentieren. Für Eltern und Fachkräfte ergibt sich daraus die Möglichkeit, Jugendliche gezielt auf Influencer*innen aufmerksam zu machen, die ein diverses und inklusives Bild vertreten.