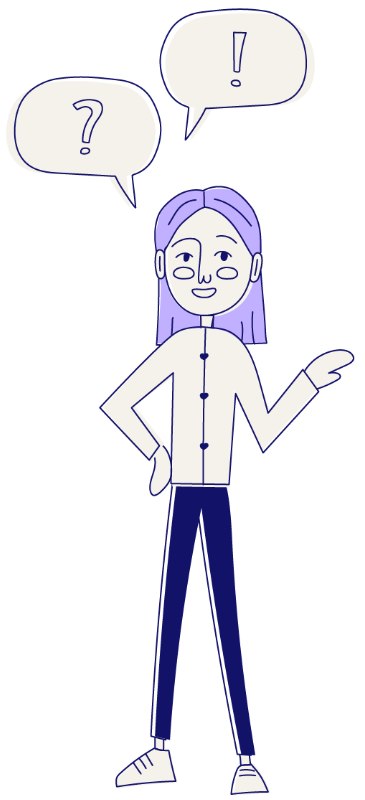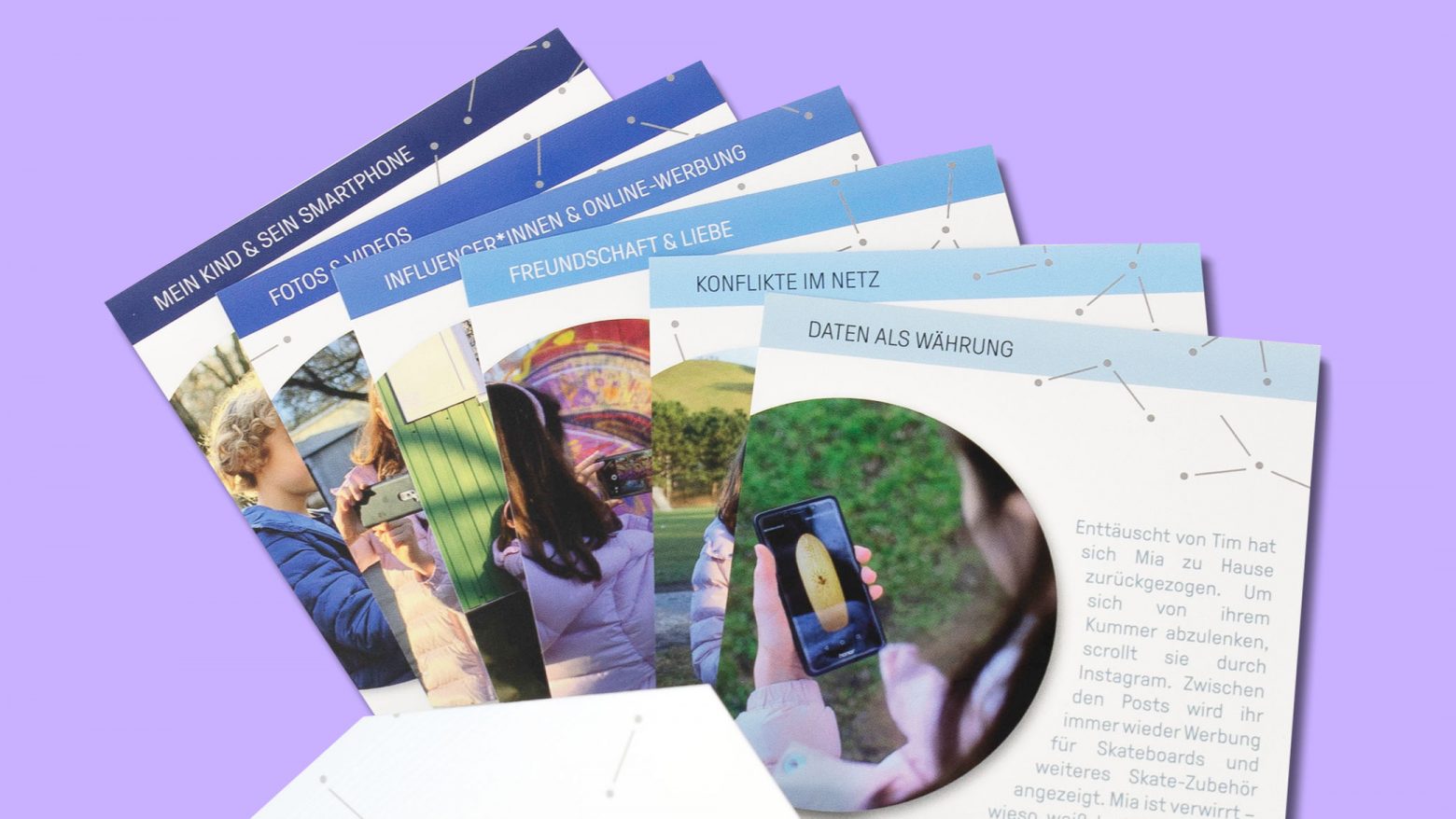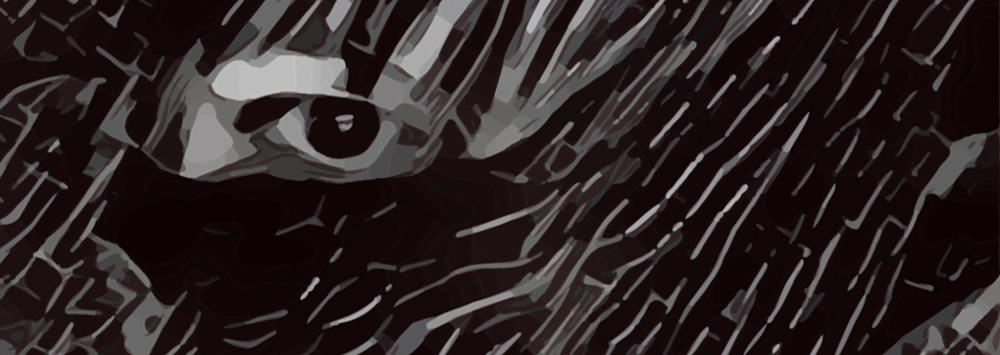Image-based sexual abuse

Auf Social Media Plattformen und in Chats ist das Teilen von Fotos und Videos selbstverständlich geworden. Doch wenn intime Bilder oder Videos ohne Einwilligung verbreitet werden, entstehen komplexe Problemlagen, die Persönlichkeitsrechte verletzen und für Betroffene schwerwiegende Folgen haben können. Dabei handelt es sich um eine Form der sexualisierten Gewalt, von der auch Kinder und Jugendliche betroffen sein können.
Was ist Image-based sexual abuse
Image-based sexual abuse (IBSA) bildet den Oberbegriff für die nicht-einvernehmliche Aufnahme, Erstellung und Weitergabe von intimen Bild- oder Videomaterial. Als “intim” gelten Inhalte, auf denen eine Person nackt oder teilweise nackt zu sehen ist. Dazu zählen Darstellungen von Genitalien, Po oder Brüsten, auch, wenn diese nur mit Unterwäsche bedeckt sind (z. B. sogenannte “Upskirting-Aufnahmen”). Ebenso fallen private Alltagssituationen wie Umziehen, Duschen oder der Toilettengang unter die Intimsphäre.
Umgangssprachlich wird für IBSA häufig der Begriff „Racheporno“ (engl. revenge porn) verwendet. Dieser greift jedoch zu kurz, da er die Tatintention auf das Motiv der Rache reduziert und die Vielschichtigkeit des Phänomens nicht abgebildet wird. Der Begriff image based sexual abuse ist daher umfassender und schließt verschiedene Formen des Missbrauchs ein, darunter:
- Androhung der Veröffentlichung intimer Aufnahmen
- Druck, Drohung oder Nötigung, intime Aufnahmen selbst anzufertigen und weiterzugeben
- Erstellung gefälschter oder digital manipulierter sexualisierter Bilder mithilfe von Künstlicher Intelligenz (Deepfakes)
- Unaufgeforderte Zusendung oder Verbreitung sexuell expliziter Bilder
IBSA kann zudem auf unterschiedlichsten Plattformen und Kanälen stattfinden: Von sozialen Netzwerken, Online-Plattformen und Messaging-Apps über Online-Spiele bis hin zu E-Mails, AirDrop oder pornografischen Websites.
Wie kommt es zu IBSA?
Zu Beginn ist klar zu betonen, dass in Fällen von image-based sexual abuse niemals die geschädigte Person selbst die Schuld trägt. Eine Studie hat sich damit beschäftigt, aus welchen Motiven image-based sexual abuse betrieben wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Täter*innen überwiegend junge Männer sind. Als Hauptgründe werden die Suche nach sozialer Anerkennung im Freundeskreis, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und „Spaß“ genannt. Darüber hinaus wurde häufig auch der Wunsch nach Macht und Kontrolle über andere Personen als Motiv angegeben.
Die Studie stellt zudem fest, dass viele Täter*innen ein mangelndes Bewusstsein für die Konsquenzen ihres Handelns aufweisen. Ihr Verhalten wird oft verharmlost oder als „keine große Sache“ betrachtet. Besonders die leichte Verfügbarkeit nicht-einvernehmlicher Inhalte auf pornografschen Websites trägt dazu bei, diesen Missbrauch zu legitimieren und zu normalisieren. Dadurch entsteht der gefährliche Eindruck, dass nicht-einvernehmliche sexuelle Handlungen als normal und gesellschaftlich akzeptabel seien.
Folgen von IBSA
Für die Betroffenen, die überwiegend weiblich sind, kann image-based sexual abuse schwerwiegende psychische Folgen haben. Viele beschreiben ihre Erfahrungen als eine Form sexueller Nötigung, deren traumatische Auswirkungen jenen von Überlebenden direkter sexueller Gewalt sehr ähnlich sind. Selbst wenn es sich bei dem verbreiteten Material um künstlich erzeugte Inhalte, etwa Deepfakes, handelt, sind Schamgefühle, Angst und psychische Belastungen oft ebenso stark ausgeprägt.
Vorgehen bei Betroffenheit
In den meisten Fällen ist es das dringendste Anliegen der Betroffenen, die Verbreitung der Inhalte so schnell wie möglich zu stoppen. Dazu sollten sie sich zunächst an die Plattform wenden, auf der das Material veröffentlicht wurde. Diese ist laut Telemediengesetz (TMG) und Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet, gemeldete Inhalte zu prüfen und zu entfernen. In der Praxis gestaltet sich das jedoch oft schwierig, insbesondere, wenn sich die Aufnahmen bereits über Messenger-Dienste oder andere private Kanäle verbreitet haben.
Darüber hinaus sollten die Täter*innen angezeigt und ein Strafantrag gestellt werden. Das Verbreiten oder Speichern intimer Aufnahmen ohne Zustimmung verletzt das Persönlichkeitsrecht und kann nach der DSGVO sowie nach Strafrecht geahndet werden. Je nach Einsatz können die Täter*innen zusätzlich wegen Beleidigung, Verleumdung oder üble Nachrede belangt werden. Bei intimen Inhalten Minderjähriger gelten besonders strenge strafrechtliche Regelungen. Für eine Anzeige ist es wichtig, Beweise zu sichern und zu dokumentieren, wo das Material veröffentlicht wurde. Dabei können Rückwärts-Bildersuchen helfen. Dennoch sollte bedacht werden, dass die Auseinandersetzung mit dem Material für Betroffene emotional sehr belastend sein kann.
Handelt es sich um Erpressung, sollte keinesfalls Geld gezahlt oder weiteres Material übermittelt werden. Nach dem Sichern der Beweise sollte jeder Kontakt mit der verantwortlichen Person sofort beendet werden etwa durch Blockieren oder Stummschalten über die jeweilige App.
Tipps und Hinweise
Eltern sollten sich bewusst machen, dass image-based sexual abuse (IBSA) weit verbreitet ist und eine ernstzunehmende Form von Gewalt darstellt. Wenn Kinder und Jugendliche davon betroffen sind, sollten Eltern und pädagogische Fachkräfte unterstützend handeln und sich bei Meldestellen oder der Polizei über das korrekte weitere Vorgehen informieren. Ebenso wichtig ist es, eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen, über Vorfälle zu sprechen. Nur wenn Betroffene wissen, dass sie ernst genommen und nicht verurteilt werden, suchen sie aktiv Hilfe und Unterstützung bei Erwachsenen. Verschiedene Beratungsstellen wie Juuuport, Hateaid oder Nummer gegen Kummer bieten zudem kostenlose Beratung für Betroffene von image-based sexual abuse an.
Ebenso wichtig ist es, zu vermeiden, dass Jugendliche zu Täter*innen werden. Dazu gehört, problematische Rollenbilder und Einstellungen frühzeitig offen anzusprechen, besonders dann, wenn Jugendliche respektloses oder grenzüberschreitendes Verhalten als gesellschaftlich akzeptabel oder alltäglich ansehen. Eltern und pädagogische Fachkräfte sollten Jugendliche dabei unterstützen, Selbstwertgefühl und Empathie zu entwickeln. Denn nur so lernen sie eigene Grenzen zu achten und die der anderen zu respektieren. Darüber hinaus ist eine altersgerechte Aufklärung über Respekt und Zustimmung wichtig: Jugendliche sollten verstehen, dass Konsens sowohl online als auch offline die Grundlage jeder Begegnung ist.