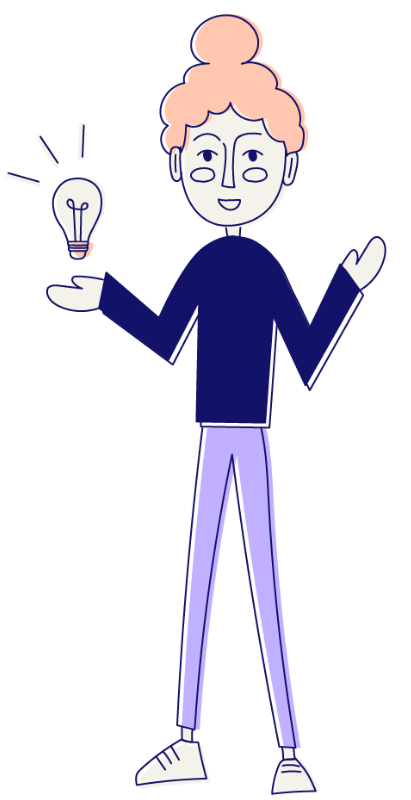Triggerwarnungen auf Social Media

Ein harmloses Scrollen durch den Feed – und plötzlich taucht ein Beitrag auf, der belastende Erinnerungen weckt. Für viele Menschen ist das eine alltägliche Erfahrung auf Social Media. Sogenannte Triggerwarnungen versprechen hier eine Lösung, um Nutzende zu schützen. Während sie in Medien wie Fernsehen oder auf Websites schon länger existieren, hat ihre Verwendung auf Social Media in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Was sind “Trigger” bzw. “Triggerwarnungen”?
Das Wort “Trigger” stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt “Auslöser”. In der Psychologie wird der Begriff für Reize verwendet, welche unbewusst traumatische Erinnerungen hervorrufen. Solche Trigger können vielfältig und sehr individuell sein. So können beispielsweise bestimmte Geräusche, Gerüche oder das Aussehen einer Person zum Trigger werden. Sie treten insbesondere bei Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen oder traumatischen Erfahrungen auf und können bei ihnen intensive Reaktionen wie Angst, Erstarren oder Zittern hervorrufen. Aber auch Menschen, die traumatisches erlebt haben, können als Folge dessen bestimmte Trigger entwickeln. Was Menschen triggert, kann dabei so unterschiedlich sein, wie die Menschen selbst. Nicht jedes Krankheitsbild ist automatisch mit bestimmten Triggern verbunden.
Triggerwarnungen sollen Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich vor für sie potenziell retraumatisierenden Inhalten zu schützen und so Flashbacks oder Angstreaktionen zu vermeiden. Insbesondere Social–Media-Plattformen, bei denen vom Algorithmus ausgewählte Videos abgespielt werden, können dafür sorgen, dass Betroffene unvermittelt mit gewissen Inhalten in Berührung kommen, die bei ihnen möglicherweise starke Reaktionen auslösen können. Wann Triggerwarnungen eingesetzt werden, unterliegt keinen Vorgaben. Die Creator*innen entscheiden selbst, ob und in welcher Form sie Triggerwarnungen aussprechen wollen. Dies kann in der Video-/Bildbeschreibung, als eingeblendeter Text oder mündlich geschehen.
Contentwarnung, Triggerwarnung oder Warnung für sensible Inhalte?
Viele Betroffene können allerdings vor Kontakt nicht genau einschätzen, welche Inhalte bei ihnen Trigger auslösen, da diese oft unbewusst gespeichert sind. Daher ist der Begriff „Triggerwarnung“ manchmal nicht ganz zutreffend. Aus diesem Grund wird mittlerweile auch immer häufiger von „Inhaltswarnung“ oder „Contentwarnung“ gesprochen, wenn es um die Darstellung von Inhalten geht, die für manche Nutzende problematisch sein könnten.
Einige Plattformen haben zudem eine automatisierte Kennzeichnung von sensiblen Inhalten. So kann in den Instagram-Einstellungen beispielsweise festgelegt werden, weniger sensible Inhalte anzuzeigen. Die Einstufung dafür erfolgt überwiegend durch KI-Algorithmen, welche Inhalte nach Anzeichen für Gewaltdarstellungen, sexuelle Inhalte oder Drogenmissbrauch analysieren. Auch bei TikTok können Nutzende unter der Einstellung “Inhaltspräferenzen” -> “Eingeschränkter Modus” gewisse Inhalte ausblenden lassen. Ähnlich wie bei Instagram beziehen sich die Einstellungen auch hier auf von Algorithmen vorsortierte Inhalte, welche in die Kategorien Gewalt, Sexualität und Rauschmittel fallen. Allerdings werden diese Inhalte nicht immer fehlerfrei kategorisiert. Darüber hinaus können Beiträge auch andere Trigger beinhalten, welche nicht von der jeweiligen Plattform berücksichtigt werden.
Positive Aspekte von Triggerwarnungen
Triggerwarnungen bieten Betroffenen die Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, mit welchen Inhalten sie sich auseinandersetzen möchten. So wird Nutzenden vermittelt, dass ihr psychisches Wohlbefinden ernstgenommen wird. Auch gesamtgesellschaftlich können Triggerwarnungen das Bewusstsein für psychische Gesundheit und die Existenz von Traumata stärken. Denn häufig sind sich Menschen nicht darüber bewusst, welche Themen und Inhalte für andere belastend sein könnten. Das Setzen von Trigger- oder Inhaltswarnungen kann hier darauf aufmerksam machen, welche Themen einen sensiblen Umgang erfordern. Ein Effekt von Triggerwarnungen für Menschen mit Trauma-Erfahrungen konnte bislang jedoch nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden.
Herausforderungen und Kritik
Trotz der positiven Absicht stehen Triggerwarnungen auch in der Kritik. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass ihr übermäßiger Einsatz die eigentliche Wirkung abschwächen könnte. Denn werden Triggerwarnungen zu oft gesetzt, gehe ihr ursprünglicher Zweck verloren und die Warnung würde nicht mehr ernstgenommen werden. Auch besteht die Sorge, dass Triggerwarnungen in manchen Fällen dazu genutzt werden, um Inhalte spannender erscheinen zu lassen und die Sensationsgier der Nutzenden zu wecken. Es stellt sich außerdem die Frage, ob Triggerwarnungen Nutzende wirklich davon abhalten, sich die sensiblen Inhalte anzuschauen. Denn in Kurzvideo–Formaten werden Themen meist binnen Sekunden angeschnitten, sodass eine sofortige Reaktion auf die Triggerwarnung erfolgen müsste. Darüber hinaus sind sehr viele Triggerwarnungen allgemein formuliert, sodass Betroffene teilweise nicht herauslesen können, ob ihre persönlichen Trigger mit dem Video ausgelöst werden. Es empfiehlt sich daher, Triggerwarnungen möglichst konkret zu formulieren. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die häufige Verwendung solcher Warnungen eine Stigmatisierung entsteht, indem unterstellt wird, dass Menschen mit bestimmten Problemen nicht in der Lage seien, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Es ist daher wichtig, Triggerwarnungen bewusst und gezielt einzusetzen, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.
Tipps und Hinweise
Triggerwarnungen tragen dazu bei, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken und einen respektvollen Umgang mit potenziell belastenden Inhalten zu fördern. Ihr gezielter und bewusster Einsatz kann dazu beitragen, die psychische Gesundheit von Nutzenden zu schützen und ein empathisches Miteinander in digitalen Räumen zu schaffen. Triggerwarnungen sind nicht nur für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Traumata relevant, sondern können allen Nutzenden die Möglichkeit bieten darüber zu entscheiden, ob sie gerade in der Verfassung sind, sich mit belastenden Themen auseinander zu setzen. Eltern könnten in einem Gespräch mit ihren Kindern darüber aufklären, welche Inhalte auf andere Menschen triggernd wirken könnten und weshalb Triggerwarnungen eingesetzt werden.
Auf Social Media ist es fast unvermeidbar, dass Jugendliche bei deren Nutzung auf belastende Inhalte stoßen werden. Wichtig ist es daher, als Elternteil oder pädagogische Fachkraft als Vertrauensperson aufzutreten und das Gesehene gemeinsam mit den Jugendlichen zu besprechen.